In Vernetzungsstrukturen ist es wie auch sonst im Leben: Da kommen Menschen zusammen, die es sich miteinander mehr oder weniger gut gehen lassen. Die Kultur der Kooperation ist ein Prozess.
Elisabeth Voß
Vernetzungen sind meist recht langwierige, oft mühsame Prozesse. Aus meinen Erfahrungen in Zusammenhängen solidarischen Wirtschaftens (früher nannten wir es Alternative Ökonomie) möchte ich einige Aspekte anhand der Beispiele TAK AÖ und Solidarische Ökonomie-Kongress beschreiben – selbstverständlich subjektiv zugespitzt und als Ausschnitte meiner persönlichen Erinnerungen. Vernetzungsprozesse entstehen in historischen Situationen als Versuche, sich mit anderen Gruppen zusammenzutun, die ähnliche Weltsichten teilen, um gemeinsame Ziele umzusetzen. So gab es nach 1968 die sogenannte Randgruppenstrategie, wonach Entrechtete und Ausgegrenzte als potenziell revolutionäre Kräfte galten. Der Theoriearbeitskreis Alternative Ökonomie (TAK AÖ) wurde 1978 unter dem Dach der Arbeitsgemeinschaft Sozialpolitischer Arbeitskreise (AG SPAK) gegründet. Diese war aus kirchlichen Student*innengemeinden entstandenen, die sich in der Arbeit mit gesellschaftlichen Randgruppen engagierte.
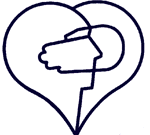
Zeit für Begegnungen?
Der TAK AÖ war „ein selbstorganisierter bundesweiter (informeller) Zusammenschluß von am Thema ‚Anderen Wirtschaftens‘ Interessierten.“ Mitglieder waren „diejenigen, die sich als solche empfinden“. Wir Beteiligte waren in unterschiedlicher Weise eingebunden in die Selbstverwaltungsszene und reflektierten im TAK AÖ vor allem das, was dort gerade aktuell war: „Ohne Handlungs- und Legitimationszwang – utopische Kreativität ist ausdrücklich erwünscht – und ohne Ausgrenzung können im Theoriearbeitskreis Themen zur alternativen Ökonomie angedacht und diskutiert werden.“
Der TAK AÖ war ein Zusammenhang von Einzelpersonen, nicht von Repräsentant*innen irgendwelcher Gruppen oder Organisationen. Ein Grundsatz der Zusammenarbeit war, dass Arbeit nicht bezahlt wird. Für Fahrtkosten wurde versucht, Fördergelder einzuwerben.
Die informelle Struktur ermöglichte Freiräume, führte jedoch auch zu fast unauflöslichen informellen Hierarchien.
Jedes Jahr organisierte der TAK AÖ vier Seminare, teilweise mit Kooperationspartnern, zum Beispiel selbstverwalteten Tagungshäusern und Landkommunen oder der Jugendbildungsstätte des DGB in Oberursel. Das Sommerseminar dauerte anfangs zwei Wochen, später eine. In selbstverwalteten Projekten arbeiteten wir vormittags mit, lernten in nachmittäglichen Seminaren gegenseitig voneinander, kochten gemeinsam und machten abends ein eigenes Kulturprogramm. Es gab auch gemeinsame Reisen zu italienischen Sozialgenossenschaften und zu einem niederländischen anarchistischen Projekteverbund. Das TAK AÖ-Logo aus Herz, Hand und Kopf symbolisierte unsere ganzheitliche Arbeitsweise.
Über konkrete Ziele unserer Zusammenkünfte haben wir nicht gesprochen, so weit ich mich erinnere, die Vernetzung reichte aus als Zweck. Es waren intensive Begegnungen, aus denen Projekte, Veröffentlichungen und auch Freundschaften und sogar Familien entstanden. Das Gefühl der Zusammengehörigkeit stellte sich auch nach Jahren bei einem Revivaltreffen 2014 wieder ein. Kurz kochten alte Konflikte hoch, aber die Freude des Wiedersehens überwog. Ein früherer Mitstreiter schickte Grüße vom Sterbebett.
Da hatte es schon seit Jahren keine Seminare mehr gegeben. Im Laufe der Jahre hatten die Leute immer weniger Zeit – lag das am Alter, oder eher am Zeitgeist? Die Sommerseminare waren zum verlängerten Wochenende geschrumpft, die Treffen dazwischen fielen aus, irgendwann schliefen sie ganz ein. Viele Teilnehmende arbeiteten längst in anderen Bereichen. Aber es entstanden immer wieder neue Netzwerke oder Vernetzungsversuche, an denen Einzelne aus diesem Zusammenhang beteiligt waren. Dabei war aber auch immer häufiger die Frage zu hören: „Wozu sollen wir uns immer vernetzen? Was nützt uns das?“ oder sogar: „Für noch eine Laberrunde habe ich keine Zeit.“
Ein klares Ziel?
Der Kongress „Wie wollen wir wirtschaften? Solidarische Ökonomie im globalisierten Kapitalismus“ im November 2006 in Berlin war strategisch darauf angelegt, den aus Lateinamerika bekannten Begriff „Solidarische Ökonomie“ auch im deutschsprachigen Raum zu verankern. Der Vorschlag kam von Sven Giegold, der heute für die Grünen im EU-Parlament sitzt. Träger war die Bewegungsakademie, die anfangs mitbeteiligte Genossenschaft der ehemaligen Ökobank, OekoGeno, war frühzeitig wieder ausgestiegen, aber das ist eine andere Geschichte.
Mitgetragen wurde der Kongress von einer Vielzahl von Organisationen, die Organisationsarbeit wurde bezahlt, aber die inhaltliche Arbeit der Vorbereitungsgruppe erfolgte unentgeltlich. Diese Zusammenarbeit, und auch die Nachbereitung für die Dokumentation, war nicht immer einfach. Die Mitglieder der Vorbereitungsgruppe kamen überwiegend von den Mitträgern und vertraten unterschiedliche Spektren alternativen Wirtschaftens.

Trotzdem trafen wir – wie in anderen Vernetzungszusammenhängen auch – vor allem als Menschen aufeinander, mit all unseren Stärken, Empfindlichkeiten und mitunter auch schwierigen Seiten. Je größer die Dringlichkeit der jeweiligen Anliegen, desto schwieriger war es mitunter, die verschiedenen Ansätze gleichberechtigt unter einen Hut zu bekommen. Vor allem Vertreter (selten Vertreterinnen) von Bedingungslosem Grundeinkommen, Regionalwährungen oder Umsonstökonomien schienen sehr überzeugt davon, dass genau ihr Ansatz die Lösung sei, nicht eine von vielen.
Immer wieder wurde um die Frage gestritten, ob wir von Solidarischer oder von Sozialer Ökonomie sprechen sollten. „Soziale Ökonomie“ („sozial“ im Sinne von gesellschaftlich, nicht von charity) war eher in Europa gebräuchlich, aber die meisten von uns bevorzugten „Solidarische Ökonomie“, weil wir diesen Begriff als kämpferischer verstanden und uns ja auch deswegen zusammengefunden hatten, um ihn bekannter zu machen.
Wie arbeiten wir zusammen?

An einem Wochenende versuchten wir, eine gemeinsame Definition für „Solidarische Ökonomie“ zu finden. Die Gesprächsatmosphäre verhärtete sich und es schien zunehmend darum zu gehen, wem es gelingt sich durchzusetzen und die anderen zu überzeugen. Unübersehbar stand die Machtfrage im Raum und je dringlicher die Notwendigkeit einer Definition gefordert wurde, desto mehr Vehemenz legten die Teilnehmenden in ihre Überzeugungsversuche. Daraus habe ich viel gelernt, vor allem, dass eine Definition den Blick verengen und Konflikte provozieren kann. Wir hätten gar keine Definition gebraucht (die wir auch nicht gefunden haben). Wozu sollten wir uns eine Definitionsmacht anmaßen? Noch dazu über eine Vielheit solidarökonomischer Betriebe und Projekte, die (mehr oder weniger) demokratische Strukturen haben, in denen die jeweils Beteiligten selbst definieren, was sie sind und wie sie sich verstehen?
In unserem Miteinander wären wir sicher besser gefahren, wenn wir uns von vornherein darauf beschränkt hätten, uns in vertrauter Runde auf unser gemeinsames Selbstverständnis zu einigen, auf die uns verbindenden Werte und Ziele. Mit dem Anspruch einer allgemeingültigen Definition debattierten wir zumindest unbewusst vor einer großen Öffentlichkeit und öffneten damit auch die Tür für patriarchale Besserwisserei und Rechthaberitis – ein Effekt, der sich auch auf Mailinglisten oft einstellt.
Ausgerechnet uns, die wir so gerne Slogans wie „Gemeinsam mehr erreichen“ und „Kooperation statt Konkurrenz“ nutzten, fiel es oft so schwer, solidarisch und ohne Machtkämpfe miteinander zu reden. Warum konnten wir uns nur so selten in einen Kreis stellen und die Vielfalt nicht nur zähneknirschend hinnehmen, sondern sie als gemeinsames Potenzial verstehen? Eine Lehre daraus ist für mich, dass für das Gelingen von Vernetzung das WIE, die Art und Weise des Umgangs miteinander, mindestens ebenso wichtig ist wie das WAS, also die Inhalte.
Rückblickend sehe ich den Kongress 2006 trotz allem als einen Kristallisationspunkt, an dem sich die Vielfalt solidarökonomischer Bewegungen im deutschsprachigen Raum zumindest gezeigt, wenn auch nicht verbindlich zusammengeschlossen hat. In unterschiedlichen Konstellationen treffen „wir“ – dieses diffuse „Wir“ der damals Dabeigewesenen und anschließend Hinzugekommenen – immer wieder aufeinander.
Gemeinsam Handeln
Nach dem Kongress gründeten einige von uns unter dem Dach von Attac 2007 eine bundesweite, und kurz darauf auch eine Berliner AG Solidarische Ökonomie. Beide gibt es nicht mehr, aber 2011 wurde daraus der Verein Forum Solidarische Ökonomie gegründet, der im Jahr darauf einen gleichnamigen Kongress an der Uni Kassel und 2015 an der TU Berlin den Solikon durchführte. Aus dem Solikon entstand das Projekt SoliOli, das auf Anregung von solidarökonomisch Aktiven in Griechenland seit 2016 jedes Jahr mit einer Kampagne Olivenöl von zwei griechischen Kooperativen verkauft und Überschüsse an politische Projekte in Griechenland spendet.
Seit drei Jahren führt ein Netzwerk von solidarischen Direkthandelsinitiativen in Berlin Diskussions- und Verkaufsveranstaltungen durch. Die Zusammenarbeit entsprang dem Wunsch, sich gegenseitig keine Konkurrenz zu machen, sondern gemeinsam stärker zu werden. Es ist unser gemeinsames Anliegen, Produkte aus besetzten Betrieben und kooperativen Strukturen unter die Leute zu bringen, und damit auch die Idee einer anderen Ökonomie zu verbreiten. Das gelingt gut, trotz unterschiedlicher Voraussetzungen – manche verdienen beispielsweise Geld mit dem Handel, andere nicht. Zusammenarbeit und personelle Überschneidungen gibt es mit der Wandelwoche, die jedes Jahr Touren zu Projekten und Veranstaltungen anderen Lebens und Arbeitens in Berlin und Brandenburg organisiert.
Eine breitere Vernetzung solidarökonomisch Aktiver im deutschsprachigen Raum, die auch im Rahmen des Weltsozialforumsprozesses für eine Transformatorische Ökonomie immer wieder angedacht war, stagniert jedoch bisher.
Elisabeth Voß war erst seit Ende der 1980er Jahre beim TAK AÖ, hat den Kongress Solidarische Ökonomie mitgestaltet, die Attac-AGs mitgegründet, bei den anderen Veranstaltungen nur mitgewirkt, und gehört zum Solihandels-Netzwerk.